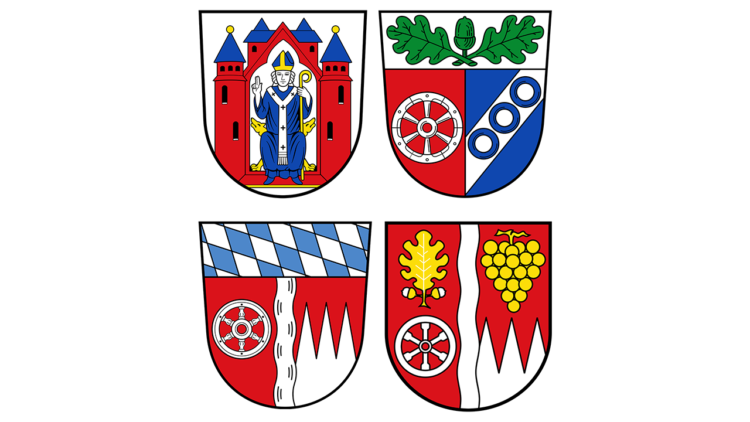Der Spessart ist eine 8.000 Jahre alte Kulturlandschaft. Die Nutzung der Landschaft durch den Menschen aber auch seine Fantasie und Vorstellungen haben Spuren hinterlassen, seien es die alten Handelswege Birkenhainer Straße und Eselsweg oder die Spessartsagen und Legenden.
Vorgeschichte
Funde urgeschichtlicher Grabstätten in verschiedenen Teilen des Spessarts sind stumme Zeugen einer frühen Besiedlung. Aus der Bronze- und Eisenzeit stammen die Hügelgräber, die man bei Alzenau und im mittleren Kahlgrund entdeckte. Auch südlich von Aschaffenburg sind Hügelgräber bei Kleinwallstadt sowie zwischen Elsenfeld und Eichelsbach erhalten. Darüber hinaus gibt es tausende von Einzelfunden: Schaber, Beile, Dolche und Pfeilspitzen sowie Gefäßscherben unterschiedlicher Epochen. Sie belegen, dass der Spessart in der Jungsteinzeit von Ackerbauern sowie später in der Bronze- und Eisenzeit besiedelt wurde. Die Hauptfundorte liegen in den Randbereichen der Täler des Mains und der Kinzig.
Erste Burgen und Wehranlagen
Von den Überresten der Fliehburgen und wehrhaften Höhensiedlungen des Spessarts sind heute Ringwälle erhalten. Man findet sie unter anderem auf dem Schloßberg bei Soden sowie bei Miltenberg auf dem Greinberg und auf dem Bürgstadter Berg. Das Unterfränkische Institut für Kulturlandschaftsforschung / Archäologisches Spessart-Projekt e.V. (ASP) hat in den letzten Jahren zahlreiche Grabungs- und Forschungsarbeiten in der Region durchgeführt.
Römer – eine Randerscheinung im Spessart
Der die fruchtbare Wetterau umschließende römische Limes stieß, von Norden kommend, bei Großkrotzenburg auf den Main und bezog den Fluss von dort ab nach Süden als natürlichen Abschnitt in sein befestigtes Grenzsystem ein. Erst in der Gegend von Miltenberg ist der Verlauf des römischen Grenzwalls gegen Germanien in seinem in südlicher Richtung über Wenschdorf geführten Verlauf wiederum erkennbar. Aus diesem Grunde finden sich bauliche Reste von Wachttürmen, Kastellen und römischen Niederlassungen nur am Westufer des Mains und im anschließenden Odenwald. Kastelle lagen u. a. in Seligenstadt, Stockstadt, Niedernberg, Obernburg, Wörth, Trennfurt und bei Miltenberg. Dort künden römische Weihesteine von Holzfällertrupps, die im Spessart Baumaterial und Brennholz zu beschaffen hatten.
Völkerwanderung
Die Periode der Völkerwanderung folgte dem Zusammenbruch des römischen Reiches. Verschiedene germanische Stämme zogen durch unsere Region, Burgunder, Alamannen und andere. Im 6. Jahrhundert übernahm eine fränkische Adelselite die Macht, mit der die christliche Religion bei uns Einzug hielt. Zeugen dieser Kultur aus dem 6. bis 8. Jahrhundert sind aufgefundene Reihengräber bei Aschaffenburg, Großostheim, Mömlingen und Niedernberg.
Mittelalter und Neuzeit
In der Karolingerzeit bis ins 9. Jahrhundert war der bayerische Spessart ein königlicher Forst. Danach ging er über an das Stift St. Peter und Alexander in Aschaffenburg und wurde so später Teil des Erzstiftes Mainz. Eine Grenzbeschreibung aus der Zeit um 1000 nennt bereits Siedlungen und Rodungsflächen mitten im Spessart.
Als Träger der kulturellen Entwicklung sind besonders die Klöster und Stifte hervorzuheben, die auf religiösem, geistigen und wirtschaftlichem Gebiet eine staunenswerte Aufbauarbeit geleistet haben. Eine der ältesten Klostergründungen neben Amorbach und Seligenstadt ist die Benediktinerabtei Neustadt am Main bei Lohr, die im späten 8. Jahrhundert entstanden ist. Später folgten Adelsgeschlechter, die in den Diensten der Kurmainzer oder Würzburger Geistlichkeit oder der Grafen von Rieneck und Herren von Hanau standen. Der magere Buntsandsteinboden und das raue Klima der Hochflächen schlossen eine Besiedlungen aus landwirtschaftlichen Gründen größtenteils aus. Es ging um die Gewinnung von Rohstoffen, zuerst um Brenn-, Bauholz und Holzkohle, Inwertsetzung von Waldgebieten durch Glasproduktion sowie um Energiegewinnung durch Mühlen und die Ausbeutung von Bodenschätzen wie z. B. Kupfer im Nordspessart bei Bieber.
Impulse lieferten die Städte um den Spessart wie z. B. Aschaffenburg über den Fürstenweg nach Lohr und über die Poststraße nach Würzburg. Wertheim griff aus in den Ostspessart mit der Gründung der Kartause Grünau und im Osten bei Homburg am Main wurde an der Mainfurt das würzburgische Stift Triefenstein errichtet. Der Nordspessart wurde von Gelnhausen aus mit seiner um 1200 erbauten Kaiserpfalz sowie ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts massiv von den Herren von Hanau beeinflusst, was zu einer vermehrten Besiedlung führte. Vom damals aktiven Burgenbau im Spessart sind nur noch wenige Anlagen, teilweise als Ruinen, vorhanden: Burgsinn, Sommerau, Mespelbrunn, Schöllkrippen, Wiesen, Rothenbuch oder Partenstein.
Keine anderen Machthaber haben den Spessart und dessen wirtschaftliche Entwicklung fast 1000 Jahre lang, von 982 bis 1803, so sehr geprägt wie die Mainzer Erzbischöfe. Sie richteten nach und nach eine Verwaltung des Forstes mit dem Zentrum in Rothenbuch ein. Niederadelige erhielten Forst- und Bachhuben, wo sie sich zum Teil schlossartige Wohnsitze schufen. Zum Schutz gegen Überfälle wurden diese befestigt und oftmals von Wassergräben umgeben (z. B. Oberaulenbach bei Eschau oder Schloss Mespelbrunn). Es galt Nutzungen zu finden, bei der die Wälder Holz lieferten und gleichzeitig als Waldweide für das Vieh dienten, insbesondere für die Bevölkerung in den Spessartdörfern, die in typischen Streifendörfern lebten (z. B. Hessenthal oder Wintersbach).
Gleichzeitig waren die jagdlichen Interessen des Erzbischofs zu beachten, so durch die Einrichtung von Tiergärten, wo Wild für Jagden und zur Fleischversorgung großgezogen wurde. Weiterhin wurde der Wald in großem Umfang für Pferdezucht genutzt. Um sicherzustellen, dass mächtige Eichen bis nach Holland verschifft werden konnten, reglementierten die Kurfürsten die forstliche und landwirtschaftliche Nutzung immer mehr.
Einen besonderen Stellenwert nahm die Glasproduktion ein. Es entstanden zahlreiche Glashütten, die mit weiteren Ansiedlungen verbunden waren. Zu ihnen gehören u. a. Wiesthal, Neuhütten, Heigenbrücken, Heinrichsthal und zuletzt Weibersbrunn mit Einsiedel im Hafenlohrtal. Im 18. Jahrhundert wurden die privaten Glashütten geschlossen und der staatliche Glashüttenbetrieb ausgebaut – mit dem glanzvollen Höhepunkt der Lohrer Spiegelglasmanufaktur.
In der frühen Neuzeit entstanden zur Ausnutzung der Wasserkraft eine Reihe von Eisenhämmern, so in Waldaschaff, Lichtenau im Hafenlohrtal und Heimbuchenthal. Mit der beginnenden Industrialisierung und wegen ihrer Entfernung von den neuen Eisenbahnlinien mussten sie im 19. Jahrhundert schließen.
Der Wald in der Defensive
Im 18. Jahrhundert führten der Bevölkerungsanstieg in den Spessartdörfern sowie der steigende Bedarf an Brenn-, Bauholz und zu einer starken Übernutzung der Wälder. Die Spessarter trieben ihr Vieh zu Weidezwecken in die Wälder und sammelten Laub als Einstreu für den Stall und als Viehfutter. In Folge dieses Raubbaus schwanden nicht nur die Holzvorräte in den Wäldern, auch die Böden laugten aus.
Zwar wurden bereits seit dem 14. Jahrhundert Forstordnungen zum Schutz des Waldes erlassen, doch erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man die Wälder nachhaltig zu bewirtschaften. Vielerorts wurde aufgeforstet, oft mit Eiche und Buche, auf den Standorten im Nordspessart vor allem mit schnellwüchsigen Fichten und Kiefern. Am Charakter der Waldlandschaft lassen sich somit bis heute die Einflüsse menschlichen Wirkens ablesen.
19. Jahrhundert bis heute
In politischer Beziehung blieb der Spessart bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu zwei Dritteln im Besitz geistlicher Fürstentümer. Der nördliche Teil stand unter der Herrschaft der Hanauer, ab 1736 als Erbe der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Wenige Teile des großen Waldgebietes gehörten Niederadelsgeschlechtern.
Die große Wende kam mit den Napoleonischen Kriegen und der Säkularisation im Jahre 1803. Durch eine Entscheidung des Wiener Kongresses gelangten die bisher zum Erzstift Mainz und zum Hochstift Würzburg gehörenden Spessartgebiete zum Königreich Bayern. Der Nordspessart wechselte 1866 von Hessen-Kassel zu Preußen und ist seit 1945 ein Bestandteil des Bundeslandes Hessen.
Das 19. Jahrhundert brachte für die Menschen im Spessart in sozialer Hinsicht keinen spürbaren Fortschritt. Bergbau, Glasproduktion und Eisenhämmer konnten mit den neuen Industriezentren in den Ballungsräumen nicht mithalten und gingen ein. Die Landwirtschaft auf den kargen Böden konnte die wachsende Bevölkerung kaum ernähren, trotz Neuerungen wie der Kartoffel. Entsprechend erlebte der Spessart im 19. und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein eine Periode noch lange prägender Armut. In vielen Familien pendelten die Männer wochen- oder monatsweise in die entstehenden Industriegebiete aus, verlegten ihren Wohnsitz dorthin oder wanderten aus. Eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten eröffnete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts z.B. im Bereich der Bekleidungsindustrie, wo eine große Zahl Spessarter Lohn und Brot fanden. Erst nach dem 2. Weltkrieg kamen die Bewohner des Spessarts mit dem Wirtschaftswunder sowie durch die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten zu Wohlstand.
Die positive Entwicklung von Gewerbe und Industrie sowie der Ausbau der Verkehrswege führte ab den 1950er Jahren zu einem starken Rückgang des Ackerbaus und der Viehhaltung im Spessart. Viele Äcker wurden aufgegeben oder in Grünlandflächen umgewandelt. Wenig rentable Wiesen und Weiden verödeten oder wurden aufgeforstet. Die ehemals intensive Nutzung der Wässerwiesen wurde bis in die 1960er Jahre eingestellt.
Parallel nahm die Bedeutung des Tourismus in der Region zu. Orte wie Heigenbrücken, Heimbuchenthal und Bad Orb entwickelten sich zu Erholungsorten. Es entstanden vielerorts Hotels, Pensionen und Campingplätze. Das Auto kam als attraktives Transportmittel auf. „Steig aus und wandere“ lautete damals die Devise.
Im 21. Jahrhundert ist der Spessart auf der Suche nach seiner Zukunft. Mit dem Spessartkongress 1994 in Bad Orb konnte ein Impuls für eine übergreifende Zusammenarbeit gesetzt werden. Mehrere Initiativen zur Entwicklung der Kulturlandschaft Spessart wurden in der Zwischenzeit intensiv diskutiert – ein von den Menschen der Region getragenes Biosphärenreservat Spessart könnte eine gemeinsame Lösung für Mensch und Natur bringen.
Text: Landratsamt Main-Spessart / Dr. Gerrit Himmelsbach (ASP)
Weitere Informationen http://www.spessartprojekt.de/